Glück der Unberechenbarkeit, Glück beim Wundern, Glück der Piazza
Original post is here eklausmeier.goip.de/wendt/2022/10-glueck-der-unberechenbarkeit-glueck-beim-wundern-glueck-der-piazza.
Der Publico-Bücherherbst I über neue Texte von Monika Maron, Harald Martenstein und Hans Kollhoff
Von Alexander Wendt / / spreu-weizen / 14 min Lesezeit

Das Glück der UnberechenbarkeitMonika Maron zeigt in ihrem Band „Essays und Briefe“, dass Distanz und Scharfsicht zusammengehören. Diese Kombination gibt es in der deutschen Literaturlandschaft nicht oft
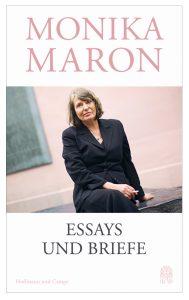
In ihrem Essay „Links bin ich schon lange nicht mehr“, erschienen 2017 in der NZZ, schrieb Monika Maron, sie gehöre nicht mehr zum heutigen linken Milieu. Vor allem werde sie von ihren Kritikern nicht mehr so wahrgenommen, und das, obwohl ihr Blick auf die Welt sich nicht grundsätzlich verändert habe. Offenbar wandelte sich die Welt vor ihren Augen stärker als die Autorin, die natürlich auch nicht über vier Jahrzehnte lang die gleiche geblieben ist. Wer kennt nicht Brechts Geschichte vom erbleichenden Herrn K., dem jemand bescheinigt, er sei ganz der Alte?
Trotzdem gibt es einige große Konstanten im Leben der heute 81-jährigen Autorin: Ihren skeptischen, distanzierten Blick auf ideologische Gebäude. Und zweitens die Lakonie ihrer Sprache, der Wille, zu beobachten. Maron gehörte nie zu dem im intellektuellen Deutschland (hauptsächlich bei anderen Intellektuellen) populären Typus der anklagenden_ moralischen Instanz_. Von beiden Qualitäten können sich die Leser in dem gerade erschienenen Band „Essays und Briefe“ auf gut 600 Seiten überzeugen. Er versammelt viele Texte, die sich schon in „Was ist eigentlich los“ finden, ergänzt um einen Essay zur deutschen Debatte um den Russlandkrieg von 2022 – und eben ihre Briefkorrespondenz. Dass eine Autorin einem Autor (Joseph von Westphalen in den achtziger Jahren) schreibt, mutet heute in angenehmer Weise antik an. Zwei Schriftsteller teilen einander mehr als jeweils 260 Twitter-Zeichen mit, jeder bemüht sich, seine Gedankengänge dem anderen nahezubringen, keiner der beiden versucht, den anderen mit seinen Argumenten zu missionieren.
Maron, geboren am 3. Juni 1941 in Berlin, Enkelin eines jüdischen, aus Polen stammenden Großvaters, wuchs in einem kommunistischen Elternhaus auf. Ihr Stiefvater Karl Maron amtierte bis 1963 als Innenminister der DDR. Von der kommunistischen Orthodoxie löste sie sich früh, was zu einem jahrelangen, später aber wieder geheilten Bruch mit ihrer Mutter führte. Seit ihrem Buch „Flugasche“ über die Umweltzerstörung in der DDR, das nur im Westen erscheinen durfte, also von 1981 bis 2020, gehörte die mit vielen Preisen ausgezeichnete Schriftstellerin zu den Autoren von S. Fischer. Dann vertrieb die damalige Verlagsleiterin Siv Bublitz die Schriftstellerin mit konstruierten, falschen Begründungen und der aus Verlagsleitungssicht authentischen Aussage, Maron sei „politisch unberechenbar“ geworden.
Wer ihren Essay- und Briefband liest, kann dieses Urteil durchaus als Auszeichnung für die Autorin verstehen. Bei Hoffmann und Campe fand sie schnell wieder eine literarische Heimat. Die damalige S. Fischer-Chefin sitzt nicht mehr auf ihrem Posten.
Durch ihre Lebensgeschichte zählt Maron weder ganz zu den ost- noch den westdeutschen Autoren, und überhaupt hielt sie sich von literarischen Kollektiven, Bewegungen, Verbänden und Großideen immer fern. Das macht ihre oft jahrzehntealten Texte gut haltbar, die zwar immer in der jeweiligen Gegenwart anknüpften, etwa ihr Essay „Warum bin ich selbst gegangen?“ von 1989 über die DDR-Ausreiser der später Achtziger und ihre eigene Ausreise, die aber immer weiterreichen als der Tag und die damals gerade aktuelle Lage. In einem Stück über die Krise des (westdeutschen) Verbandes Deutscher Schriftsteller, damals Anhängsel der Mediengewerkschaft, schrieb sie 1989: „Ich frage mich, ob Schriftsteller in einer Massenorganisation, die ihrer Natur nach von Ideologen und Pragmatikern regiert wird, überhaupt etwas zu suchen haben.“
Diese instinktive Distanz schützte die Autorin vor allen großen Irrtümern. Kurioserweise meinten viele, die Maron in den Neunzigern für ihre nüchterne Sicht auf die DDR lobten (dass sie damit richtig gelegen hatte, merkte spätestens dann jeder), die Autorin sei abgedriftet und habe sich verirrt, als sie nach 2015 die aufkommende Erwachtheitsideologie im Westen kritisierte, die Verklärung des politischen Islam, den Paternalismus der politisch-medialen Eliten. Dass jemand, der schon das eine sehr viel klarer gesehen hatte als viele westliche Linke, mit seiner Distanz und Reflexionsfähigkeit auch andere Phänomene vielleicht deutlicher wahrnimmt als etliche Zeitgenossen, den Gedanken müssen Marons Kritiker mit Zuschreibungen wie ‘neurechts‘ wahrscheinlich deshalb so engagiert wegwedeln, weil mindestens jeder Zweite von ihnen insgeheim ahnt, dass auch ihre neuen Essays in zehn oder vierzig Jahren ihre Gültigkeit nicht verlieren werden.
In ihrem Essay „Zeitunglesen“, der im Untertitel die Frage „bin ich vielleicht verrückt geworden?“ stellt (erschienen 2013 im Spiegel, der jetzt vermutlich keinen Text von ihr mehr drucken würde), schreibt sie über die neuen medialen Begriffe, die ein bestimmtes Denken nicht mehr erklären, sondern pathologisieren, etwa mit der Wendung „Islamophobie“. Das, so erfährt sie bei der Zeitungslektüre, sei kein legitimer Standpunkt, sondern eine Angststörung, also etwas Behandlungsbedürftiges. „Hätte ich es nicht wenigstens hundertmal schwarz auf weiß gelesen, wüsste ich wahrscheinlich heute noch nichts von meiner Krankheit“, schieb Maron damals. „Das ist eben das Gefährliche an der Krankheit: man hat sie, ohne das Geringste zu bemerken. Deshalb halten es die Zeitungen für ihre Pflicht, Menschen wie mich darüber aufzuklären, dass sie, ohne es zu wissen, längst von dieser sich seuchenartig verbreitenden Krankheit infiziert sind.“ Wenn sich jemand fragt, ob er verrückt sein könnte, muss das kein schlechtes Zeichen sein. Wirklich Verrückte fragen sich das nie.
Neben ihren politischen Texten gibt es in „Essays und Briefe“ auch viel Lebensweltliches im lakonisch-gelassenen Maron-Stil. Etwa, wenn sie über Berliner und Hunde schreibt. Aber Vorsicht: Als ihr Band über ihre Hündin Bonnie Propeller erschien, stocherte eine Deutschlandfunk-Redakteurin ausgiebig darin herum, weil sie versteckte politische Botschaften darin vermutete. Einmal als problematische Autorin etikettiert und damit verdächtig, immer verdächtig.
Gerade Leser, die schon viel von ihr kennen, lesen die „Essays und Briefe“ vermutlich mit Gewinn, denn hier finden sich viele Motive aus ihren Romanen in anderer Form wieder. Etwa ihr Essay über Ernst Toller, einen Autor, über den auch Marons Erzählerin in „Artur Lanz“ nachdenkt.
Mehrmals kommt sie auch auf ein anderes Grundmotiv, das in ihren späten Büchern eine Rolle spielt: das Landleben. Nur wenige deutsche Autoren entwickelten dazu einen Bezug ganz ohne Herablassung, niemand sicherlich besser als Fontane. Aber auch bei Maron findet sich dieser Ton ohne jede Anwandlung von Kitsch. In „Schreiben auf dem Lande“ heißt es: „Unser Nachbar ist Bauer. Er liest die Zeitung und ab und zu ein Buch über Tiere. Dass ich Bücher schreibe, weiß er und findet es nicht weiter schlimm. Abends fragt er, ob ich etwas geschafft habe. Wenn ich in der glücklichen Lage bin, die Frage zu bejahen, sagt er: ‚Dann is jut.‘ – ‚Bist bald fertig, wat?‘, fragt er vielleicht noch und sieht mich dabei an wie einen Menschen, der sein Tagwerk ehrlich hinter sich gebracht hat wie er selbst.“
In Beobachtungsdistanz zu sich selbst beschreibt sie das „Süßliche und Milde, das Betörende und Verdächtige, von dem ich die Bezeichnung nicht kenne und von dem ich befürchte, dass es auf einem Irrtum beruht.“ Das Codewort, das sie etwas abergläubisch umkreist, heißt Glück.
Als Glück bezeichnete sie es ganz direkt, als sie nach ihren Erfahrungen mit S. Fischer bei Hoffmann und Campe ankam, und der Verlag sich entschied, alle ihre Bücher aus 40 Jahren dort noch einmal herauszubringen.
Das beruht nicht auf einem Irrtum, zur Freude ihres Publikums.
Monika Maron „Essays und Briefe“, Hoffmann und Campe, 608 Seiten, 34 Euro
Der ältere weiße Mann und die FischrettungHarald Martenstein wundert sich in seiner Kolumnensammlung, versucht, die Welt zu verstehen, und gibt praktische Ratschläge. Das ist unterhaltsam, oft komisch, manchmal e_rnst_

Seine Leser kennen Harald Martenstein als Autor und Kolumnist. Hauptsächlich gibt er praktische Hinweise zur Lebensbewältigung, egal in welcher Rolle. Es handelt sich meist um Erfahrungen, die er seinerseits bei der Bewältigung des Lebens sammelt. „Im April habe ich eine Jalousie bestellt, wegen des Aquariums“, schreibt er in einem seiner Kolumnentexte: „Das Aquarium steht am Fenster, das Wasser heizt sich auf, die Fische werden gekocht. Ein Mann hat das Fenster ausgemessen. Wochen später kam ein zweiter Mann mit der fertigen Jalousie und stellte fest, dass sein Kollege, Mann Nummer eins, sich um zehn Zentimeter vermessen hat. Der zweite Mann sagte, dass es immer schwieriger wird, Menschen zu finden, die mehrstellige Zahlen richtig ablesen können, das sei ein ungelöstes Problem in Deutschland. Ich schütte jetzt täglich Eiswürfel ins Aquarium.“
Das rettet nicht die Welt, aber immerhin die Fische.
Martensteins Texte funktionieren ähnlich wie die Eiswürfel für das überhitzungsbedrohte Aquarium. Sie wirken erstens regulierend und lindernd. Und zweitens teilt er sie in kleinen gleichbleibenden Portionen aus, nämlich in Gestalt seiner Kolumnen. „Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff“ versammelt Martensteins Kurztexte aus etlichen Jahren. Der Untertitel lautet „Optimistische Kolumnen“. Er führt in die Irre, denn die Tonlage des Autors klingt zwar fast immer zuversichtlich. Dem steht allerdings öfter die Natur seiner Themen entgegen, vor allem dann, wenn er über Gesellschaftspolitik schreibt. Aus dieser Dissonanz ergibt sich die Komik meist fast von selbst.
Martenstein, geboren 1953 in Mainz, schrieb mehr als 30 Jahre lang seine Kolumnen für den Tagesspiegel, bis die Chefredaktion des Blattes Anfang 2022 einen Text von ihm löschte, in dem er Demonstranten, die gegen Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen waren, gegen den Pauschalvorwurf des Antisemitismus verteidigte. Deshalb, aber auch, weil die Tagesspiegel-Leitung die Affäre nach außen hin kontrafaktisch darstellte, verließ er die Zeitung und wechselte zur Welt. Seine Texte der Anthologie „Alles im Griff“ erschien noch vor diesem Eklat. Aber er deutet sich darin schon an.
Von sich sagte der Autor einmal, er habe fast 30 Jahre eigentlich immer nur nett geschrieben. Aber schon 2013 erschienen die ersten Texte vom ihm, in denen er sich fragte, wie ein Glaubenssystem namens Gender Studies mit Universitäten und Wissenschaftsbetrieb zusammenpasst. Nett und problemlösungsorientiert, wie es in ihm offenbar von Natur aus angelegt ist, rief er einer Kaiserin also zu, sie habe ja gar nichts an, und meinte, ihr damit einen nützlichen Hinweis gegeben zu haben.
In einem Text– „Pronomenrunden“ – beschreibt er die Praxis an Universitäten, hier: der Uni Freiburg, in bestimmten Gremien erst einmal reihum mitzuteilen, mit welchem Pronomen die Teilnehmer angesprochen zu werden wünschen, beispielsweise er, sie es, x, per oder hän. „Hän ist Finnisch und neutral. Hän ist praktisch die Schweiz unter den Pronomen.“ Aber auch die allerreichste Pronomenlandschaft kann unmöglich jedem und jeder gerecht werden, was wiederum Leid verursacht, weshalb Martenstein auch hier wieder seine Eiswürfelportion austeilt: „Die einzige Lösung wäre Schweigen. Dann ist im Seminar garantiert niemand verletzt, und niemand muss weinen.“
Nur bei manchen Themen fällt ihm keine praktische Empfehlung mehr ein. Etwa, wenn er darüber schreibt, dass sein Verlag Thilo Sarrazins Buch „Feindliche Übernahme“ nicht veröffentlichen wollte (nachdem er vorher mit anderen Sarrazin-Büchern gut verdient hatte). Der Verleger begründete das in einer Stellungnahme, in der er auch die „Gefahr eines neuen Faschismus“ erwähnt.
Für die Publikationsfreiheit blieb die Verbannung des Buchs ohne Folgen. Sarrazin veröffentlichte „Feindliche Übernahme“ eben in einem anderen Verlag als dem, der auch Martenstein verlegt. Aber, so Martenstein, es verändere die Struktur der Öffentlichkeit: „Es entstehen zwei verschiedene Öffentlichkeiten. Die Gesellschaft ändert sich. Auf der einen Seite die etablierten Verlage, auf der anderen Seite die Webzeitungen und Verlage, wo die anderen zu finden sind, die Kritiker der Hypermoral, des Islam, der Einwanderungspolitik. Immer mehr Leute, die ich kenne, informieren sich nur noch auf der einen oder anderen Seite dieser unsichtbaren Barrikade.“
Apropos Barrikade: Einer seiner Kritiker schrieb einmal, Martenstein stehe „stellvertretend für die sich für schweigend haltende Mehrheit weißer, heterosexueller, alter Männer, die die Welt nicht mehr verstehen“, und er schreibe gegen ihren Machtverlust an.
Mit seinem Gestus, sich in seinen Texten zu wundern, versteht er sie allerdings erstaunlich gut. Und zu heterosexueller weißer Mann würde er wahrscheinlich bemerken, das sei nun mal seine Identität, so werde er auf der Straße gelesen. Der britische Komiker John Cleese twitterte vor einiger Zeit: „In meinem tiefsten Inneren wäre ich gern eine kambodschanische Polizistin.“ Dann würde er vermutlich auch andere Scherze machen. Martenstein geht es da bestimmt ähnlich.
Neben seiner Eigenschaft als weißer Heteromann ist Martenstein auch noch später Vater, Berliner und, wie schon erwähnt, Alltagsbewältiger. In seinem Buch finden sich also auch Texte, die Erziehungsprobleme behandeln oder die Frage, was in Berlin bei einem Wasserrohrbruch passiert. Auch Jüngere, Nichtmänner, Nichtheterosexuelle und Nichtweiße können daran Spaß haben. Möglicherweise dienen auch Pronomenrunden zur Kompensation von Ohnmachtsgefühlen. Die Art und Weise, wie hier ein älterer Mann gegen seinen Macht- und gelegentlichen Verständnisverlust anschreibt, wirkt allerdings deutlich unterhaltsamer.
Harald Martenstein: „Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff. Optimistische Kolumnen“, Bertelsmann, 224 Seiten Seiten, 18 Euro
Vom Glück des schönen BauensDer Architekt Hans Kollhof rechnet mit den Dauermodernisierern seines Berufsstandes ab – und skizziert einen konservativen Gegenentwurf
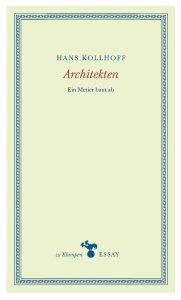
Architekturmanifeste gab es in der jüngeren Geschichte viele. Organische Städte allerdings, darin liegt der Argumentationskern des Autors und Baumeisters Hans Kollhoff in dem schmalen, wichtigen Buch „Architekten. Ein Milieu baut ab“ entstanden aber immer anders. Kollhoff, Jahrgang 1946, nimmt sich hier vor allem die ökologische Stadtgestaltung vor, mit der die Bundesarchitektenkammer nach eigener Erklärung neuerdings „auf die Zukunft bauen“ will, in enger Verbindung zu dem durch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ausgerufenen „europäischen Bauhaus“.
Ihnen hält der Traditionalist entgegen, dass gerade dann, wenn energetische, vor allem aber ästhetische Nachhaltigkeit tatsächlich eine Rolle spielen sollen, wenig bis nichts neu erfunden werden muss: „Die ganz alte Stadt ist die ganz neue.“ Der Autor breitet wie in einem Spaziergang in seinem Essay aus, warum die italienische Stadt, das Ensemble von „Haus, Garten, Straße, Park und Platz“ in allem die Ansprüche an Wohnen nach menschlichem Maß so gut erfüllt, dass Architekten sich im Grunde auf den Wert der Tradition besinnen müssten, die nur Weiterentwicklung braucht, aber keine Abrisskugel.
Hier schreibt jemand so elegant, gelassen und kenntnisreich über Architektur- und Stadtgeschichte, dass der Leser sich seitenweise an Jacob Burckhardt erinnert fühlt.
Hans Kollhoff „Architekten. Ein Milieu baut ab“, Zu Klampen, 128 Seiten, 14 Euro
Die Rezension von Monika Marons „Essays und Briefe» erscheint auch auf Tichys Einblick.
3 Kommentare
Original: Glück der Unberechenbarkeit, Glück beim Wundern, Glück der Piazza
Liebe Leser von Publico: Dieses Onlinemagazin erfüllt wie eine Reihe von anderen Medien, die in den letzten Jahren entstanden sind, eine zentrale und früher auch allgemein selbstverständliche publizistische Aufgabe:
Es konzentriert sich auf Regierungs- und Gesellschaftskritik.
Offensichtlich besteht ein großes Interesse an Essays und Recherchen, die diesen Anspruch erfüllen.
Das jedenfalls zeigen die steigenden Zugriffszahlen.
Kritik und Streit gehören zur Essenz einer offenen Gesellschaft.
Für einen zivilisierten Streit braucht es gut begründete Argumente und Meinungen, Informationen und Dokumentationen von Fakten.
Publico versucht das mit seinen sehr bescheidenen Mitteln Woche für Woche aufs Neue zu bieten.
Dafür erhält dieses Magazin selbstverständlich kein Steuergeld aus dem Medienförderungstopf der Kulturstaatsministerin Claudia Roth, kein Geld aus dem Fonds der Bundeszentrale für politische Bildung (obwohl Publico zur politischen Bildung beiträgt) und auch keine Überweisungen von Stiftungen, hinter denen wohlmeinende Milliardäre stehen.
Ganz im Vertrauen: Publico möchte dieses Geld auch nicht.
Die einzige Verbindung zu diesen staatlichen Fördergeldern besteht darin, dass der Gründer des Magazins genauso wie seine Autoren mit seinen Steuern dazu beiträgt, dass ganz bestimmte Anbieter auf dem Medien- und Meinungsmarkt keine Geldsorgen kennen.
Es gibt nur eine Instanz, von der Publico Unterstützung annimmt, und der dieses Medium überhaupt seine Existenz verdankt: die Leserschaft.
Alle Leser von Publico, die uns mit ihren Beiträgen unterstützen, machen es uns möglich, immer wieder ausführliche Recherchen, Dossiers und Widerlegungen von Falschbehauptungen anzubieten, Reportagen und Rezensionen.
Außerdem noch den montäglichen Cartoon von Bernd Zeller. Und das alles ohne Bezahlschranke und Abo-Modell. Wer unterstützt, sorgt also auch für die (wachsende) Reichweite dieses Mediums.
Publico kann dadurch seinen Autoren Honorare zahlen, die sich nicht wesentlich von denen großer Konzernmedien unterscheiden (und wir würden gern noch besser zahlen, wenn wir könnten, auch der unersetzlichen Redakteurin, die Titelgrafiken entwirft, Fehler ausmerzt, Leserzuschriften durchsieht und vieles mehr).
Jeder Beitrag hilft.
Sie sind vermutlich weder Claudia Roth noch Milliardär.
Trotzdem können Sie die Medienlandschaft in Deutschland beeinflussen.
Und das schon mit kleinem Einsatz.
Der Betrag Ihrer Wahl findet seinen Weg via PayPal – oder per Überweisung auf das Konto
(Achtung, neue Bankverbindung!)
A. Wendt/Publico
DE88 7004 0045 0890 5366 00,
BIC: COBADEFFXXX
Dafür herzlichen Dank.
Die Redaktion
kdm
9. Oktober, 2022Zu Zeiten, als Frau Maron in der ZEIT noch den regelmäßigen Briefwechsel mit einem bayerischen Zyniker publizierte, war ich als Leser voll auf Seiten des Bayern. Inzwischen nicht mehr. Man wird älter.
Thomas
10. Oktober, 2022Martenstein
kann gut beschreiben. Er geht seinen Weg und hat mich enttäuscht. Das war das Ende einer Täuschung, einer Selbsttäuschung. Nun ist das aber eben sein Leben und meine Enttäuschung – und daß man sein Leben in Deutschland im Allgemeinen trotz aller Beschwerlichkeiten gut leben kann, das ist die gute Nachricht. Bei Martenstein liest sich das sehr heiter. Das ist gut.
Majestyk
25. Oktober, 2022Für mich nicht nachvolziehbar, daß ein zeitgeistkritisches Medium eine Type wie Martenstein hofiert. Für den ist Impfung Bürgerpflicht im Kampf gegen rechts und Pandemiekritik ein Zeichen für Faschismus. Außerdem möchte der keine Menschen gegen den Instrumentenkasten des Staates demonstrieren sehen. Liegt vermutlich an mir, gehe ungeimpft auf zwei Beinen durchs Leben, auch auf meinem rechten.