Unwahrscheinliche Liebe, unwahrscheinliches Debüt, unwahrscheinliche Revolution:
der Publico-Literaturfrühling 2022 (I)
Original post is here eklausmeier.goip.de/wendt/2022/04-unwahrscheinliche-liebe-unwahrscheinliches-debuet-unwahrscheinliche-revolutionder-publico-literaturfruehling-2022-i.
Buchempfehlungen zu Ostern: Michel Houellebecq, Frank Böckelmann, Jörg Baberowski und andere
Von Alexander Wendt / / spreu-weizen / 33 min Lesezeit

Lass uns mit der Liebe beginnen, jetzt, wo alles zu Ende geht
Mit „Vernichten“ erzählt Michel Houellebecq die Geschichte einer unwahrscheinlichen Heilung. In seinem scheinbar sanften neuen Roman ist der Autor politisch wie eh und je. Denn in der Welt, die er entwirft, werden Provinz, Familie und Bindung plötzlich zur Subversion
Jeder Roman von Michel Houellebecq ist ein literarisches Ereignis, unabhängig von seinem Stoff, sogar unabhängig von seiner Qualität, die bei ihm wie bei fast allen Autoren schwankt. Alle seine Romane handeln von der gegenwärtigen Gesellschaft Frankreichs und im weiteren Sinn des Westens. Auch sein neuestes Werk, „Vernichten“, das im Jahr 2027 spielt.
Um es gleich zu sagen, es gibt von Houellebecq kürzere und auch dichtere Bücher. In seinem Erstling „Ausweitung der Kampfzone“ von 1994 brauchte er nur 155 Seiten, um eine Geschichte zu erzählen, die der Leser nicht mehr vergisst. „Vernichten“ füllt 615 Seiten, was nicht nur, aber auch an dem liegt, worüber er schreibt: Es handelt sich um einen beinahe klassischen Familienroman, doppelt eingerahmt durch eine politische Nebenhandlung und einen globalen Geheimdienstplot. Ganz zum Schluss, in der Danksagung, deutet Houellebecq an, dieser Roman sei sein letzter („für mich ist es Zeit, aufzuhören“). Natürlich könnte es bei einem Autor wie ihm auch ganz anders kommen. Aber „Vernichten“ wirkt tatsächlich wie ein sehr großer, geradezu ausladender Schlusspunkt in seinem Werk, weil der Roman trotz des Titels und trotz des Stoffs (Krise, Krankheit, naher Tod) einen gut verpackten Kern in sich trägt, mit dem sich Houellebecq bisher noch nie so intensiv beschäftigt hatte: Der Autor erzählt auf eine paradoxe und sehr houellebecqistische Weise von Heilung, vom Wiedergutwerden einer eigentlich schon zerstörten Liebesbeziehung.
In der Büchse der Pandora steckte bekanntlich neben dem vielgestaltigen Unglück auch die Hoffnung (die in der Büchse bleibt, weil deren Deckel dann zu schnell wieder verschlossen wird). „Vernichten“ entspricht ziemlich genau diesem Pandoraprinzip. Auch hier muss der Leser zusehen, dass ihm das Heilungs- und Hoffnungsmotiv nicht entgeht.
Wie immer bei diesem Autor steht ein mittelalter gutsituierter Mann aus dem bürgerlichen Milieu im Zentrum des Geschehens. Das Sechshundert-Seiten-Schwergewicht erzählt die Geschichte von Paul Raison, knapp fünfzig, ENA-Absolvent, Beamter und einer der engsten Mitarbeiter des französischen Wirtschaftsministers Bruno Juge. Von Paris und dem Ministerium aus wirft Houellebecq sein episches Netz über Pauls Familie und in die französische Provinz. Dort, aus Pariser Sicht in der Peripherie und unter sehr normalen, fast biederen Leuten spielt ein großer Teil des Romans. Der Autor verbirgt nicht, dass er mit diesem Personal sympathisiert. Kaum etwas lässt sich so schwer beschreiben wie das Biedere, erst Recht für jemand wie Houellebecq, dessen Blick nie zynisch ist – diese Unterstellung zählt zu den größten Missverständnissen seiner Kritiker – andererseits aber auch völlig unverklärt.
In dem Leben dieser normalen Leute in dem kleinen Ort namens Saint-Joseph, gruppiert um Pauls von einem Schlaganfall gelähmten Vater liegt allerdings etwas Subversives unter den Bedingungen des leicht dystopischen Frankreichs von 2027, in dem „Vernichten“ spielt. Figuren an der Peripherie wie Pauls Schwester Cécile und ihr Mann Hervé leben längst nicht mehr mit dem Strom der Gesellschaft. Sie leben dagegen an, genauso wie die Freundin des Vaters und Pauls Bruder Aurélien.
In diesem nicht so fernen Land geht die Teilung noch tiefer als heute; die Wirtschaft der Großunternehmen floriert wieder, auch dank der Politik des begabten Technokraten Juge lassen französische Autohersteller ihre deutschen Konkurrenten sogar hinter sich. In vielen Gegenden jenseits von Paris und den großen Städten gehören Verarmung und Verfall trotzdem zur Normalität. Niemand glaubt dort ernsthaft noch an eine Wende zum Besseren. Gesellschaftliche Kommunikation gibt es fast nur noch durch das Fernsehen und die Internetplattformen, die Presse hat, wie es an einer Stelle heißt, „fast alle ihrer Leser verloren“. In dem Jahr der Handlung, 2027, tritt ein bekannter Fernsehkomiker als aussichtsreicher Präsidentschaftskandidat an.
Auf diese Gesellschaft, in der die Teile nur noch lose zusammenhängen, trifft die Anschlagsserie einer anonymen Untergrundbewegung, die Botschaften in einer unentzifferbaren Zeichensprache zusammen mit Aufnahmen ihrer Aktionen über das Internet sendet. Ganz am Anfang des Romans verbreiten die Unbekannten ein computergeneriertes Video, das die Hinrichtung Juges mittels einer Guillotine zeigt, wobei die Animation so perfekt wirkt, dass sich die Experten des Geheimdienstes DGSI die Frage stellen, welche Organisation über die dafür nötigen Großrechner verfügt. Auf die virtuelle Enthauptung folgt ein echter Anschlag, die Versenkung eines chinesischen Containerschiffs mit Kurs auf Europa durch ein technisch avanciertes Torpedo, mit der die unbekannte Terrororganisation alle Lieferketten aus Ostasien in Frage stellt.
In diesem Romanstrang entwirft Houellebecq ganz nebenbei eine Entglobalisierung mit erstaunlichem Anklang an das Decoupling der Handelsbeziehungen zu Russland und auch zu China, an dem sich Politiker des Westens gerade versuchen. Der Autor beweist nicht zum ersten Mal sein Talent zur literarischen Vorahnung; sein Roman „Unterwerfung“ über eine islamische Machtübernahme in Frankreich erschien am 7. Januar 2015, dem Tag des Massakers in der Redaktion des Satireblatts „Charlie Hebdo“. Der Plot von der apokryphen Macht im Untergrund und dem Versuch des Geheimdienstes, wenigstens den Sinn der Anschläge zu entschlüsseln, führt zwar zu Paul, denn sein Vater, ein pensionierter DGSI-Mann, scheint etwas über die Hintergründe zu wissen. Mit dieser Fährte täuscht Houellebecq seine Leser. Was wie ein Thriller im Stil von Thomas Pynchon beginnt, führt ganz woanders hin.
Auch in Pauls Leben hängen die einzelnen Teile seiner Existenz am Beginn der über 600 Seiten bestenfalls noch schwach aneinander. Mit seiner Frau Prudence lebt er seit zehn Jahren in einer zwischen den beiden aufgeteilten Eigentumswohnung, selbst im Kühlschrank herrscht eine strikte Trennung zwischen seinem und ihrem Bereich. Um ihre kalte Ehe zu beschreiben, genügt Houellebecq ein Satz (was ihn nicht daran hindert, noch mehr dieser Programmsätze zu schreiben): „Allein zu schlafen fällt schwer, wenn man nicht mehr daran gewöhnt ist, man friert und fürchtet sich; doch dieses beschwerliche Stadium hatten sie längst hinter sich gelassen; sie hatten eine Art vereinheitlichte Hoffnungslosigkeit erreicht.“
Mit seiner Kleinstadtfamilie pflegt er wenig Kontakt. Einen großen Teil seiner Zeit verbringt Paul im Ministerium. Seine Träume – ihren Schilderungen gönnt der Autor viel Platz – handeln im Grunde alle davon, dass sich selbst seine dünnen Bindungen an andere Personen und an einen bestimmten Ort noch lösen.
„Vernichten“ kehrt den Lauf klassischer Familenromane um, die üblicherweise von einem Niedergang erzählen. Nach dem Schlaganfall seines Vaters fährt Paul nach Saint-Joseph, auch die anderen Familienmitglieder kommen in dem Haus der Eltern zusammen. Dort stellt Paul fest, dass es doch noch so etwas wie eine letzte, aber eben auch elementare Bildung gibt. In der Provinz entsteht um ihn herum eine Gegenwelt, die er bisher höchstens im Augenwinkel wahrgenommen hatte. Zu den kleinen, aber bedeutenden Fußnoten dieser Schilderung gehört, dass Paul, der politisch etwa in der Mitte steht, einen Modus mit seinem Schwager Hervé findet, der ganz selbstverständlich Le Pen wählt und nie etwas anders wählen würde. Auch darin liegt das Motiv einer Heilung: Es muss nicht alles ausgekämpft werden. Wo das Politische nicht mehr verbindet, kann das Private und Familiäre trotzdem und sogar erst recht existieren.
„Familie und Ehe“, lässt Houllebecq seine Hauptfigur in einer der vielen halbessayistischen Passagen denken, „waren die beiden verbliebenen Pole, die das Leben der letzten Bewohner des Abendlandes in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts ordneten. Andere Modelle waren von Menschen, denen das Verdienst zukam, die Abnutzungserscheinungen der traditionellen Modelle vorauszuahnen, vergeblich in Betracht gezogen worden, ohne dass es ihnen gelungen wäre, neue zu entwickeln, und deren historische Rolle war daher gänzlich negativ gewesen. Die liberale Doxa ignorierte weiterhin beharrlich das Problem, erfüllt von ihrem ebenso unbedingten wie naiven Glauben, das Lockmittel des Profits könnte jeden anderen menschlichen Ansporn ersetzen und allein die für die Aufrechterhaltung einer komplexen sozialen Organisation erfolgreiche geistige Energie hervorbringen.”
Mit Hilfe einer anderen, gewaltlosen Untergrundorganisation entführt die Familie den gelähmten Vater aus dem Krankenhaus und bringt ihn wieder nach Hause (aus rechtlichen Gründen ist es in dem Land, das er beschreibt, gar nicht so einfach, jemand aus dem Gesundheitssystem herauszuholen, der sich selbst nicht mehr artikulieren kann). Ungefähr in der Mitte des Buchs ereignet sich die unwahrscheinliche Wende; in der Wärmestube von Provinz und Familienumgebung endet die zehnjährige Eiszeit zwischen Paul und Prudence. Zwei mittelalte Menschen, die in Paris nur noch aus Konvention zusammenhingen, finden wieder zusammen. Geheimdienst, Anschläge und Präsidentenwahl erzeugen von jetzt an nur noch das erzählerisches Hintergrundrauschen zu dieser völlig unwahrscheinlichen Fügung. Natürlich verschwindet die bindungslose Welt dadurch nicht. Sie rückt nur vorübergehend an den Rand.
„Paul hatte Menschen gekannt“, heißt es in einer Art Resümee, „die nicht im Traum daran gedacht hätten, ein einmal gegebenes Wort zurückzunehmen, bei ihnen war es nicht einmal nötig, auf die Formalität des Versprechens zurückzugreifen. Es war überraschend, dass es solche Menschen immer noch gab, und das nicht einmal allzu selten. Seit ungefähr einem Jahrhundert waren immer mehr Menschen anderer Art aufgetaucht; sie waren spaßig und schmierig, sie besaßen nicht einmal mehr die relative Unschuld von Affen, sie waren beseelt von der höllischen Mission, jedes Band zu zernagen und zu zerfressen, alles, was notwendig und menschlich war, zu zerstören. Leider hatten sie am Ende die breite Öffentlichkeit, die einfachen Menschen erreicht.”
Diese Geschichte rührt den Leser an, zumal am Ende dann doch keine endgültige Heilung steht, sondern das Gegenteil.
Bei einem Autor wie Houellebecq spielt es immer eine Rolle, wie er erzählt. Auch darin unterscheidet sich „Vernichten“ von seinen Vorgängern. Und zwar nicht nur durch seinen Umfang. Nach den ersten Seiten, die im Geheimdienst spielen, erzählt der Autor ganz klassisch durch die Augen seiner Hauptfigur. Etwa in der Mitte spaltet Houellebecq ohne erkennbares Motiv die Perspektive, der Leser folgt für eine Weile der Schwester Cécile, dann Aurélien, um später wieder zu Paul zurückzukehren. Längere reflektierende Passagen lösen sich nicht in Handlung auf, sie stehen wie Essays im mäandernden Erzählfluss. Wobei auch die sich auf der Höhe des Autors bewegen, etwa, wenn er seinen Minister Juge eine ganze Abhandlung über Fortschrittsglauben und Reaktion in den Mund legt, in der er, überraschend genug, aus Alfred de Mussets radikal antimodernistischem Poem Rolla zitiert.
Alles in allem hätte die Streichung von gut hundert Seiten dem Roman nicht geschadet. In der Lässigkeit und manchmal Nachlässigkeit, mit der er schreibt, liegt andererseits etwas Hinreißendes. „Vernichten“ ist ein Alterswerk mit breitem Pinsel und einer bemerkenswerten Geringschätzung für Konventionen.
In einem Punkt folgt er allerdings wieder der wichtigsten Regel für einen Roman, zumal für alles über 500 Seiten: Es geht um Leben und Tod. Der Schlusssatz (er gehört Prudence) gehört zu der Kategorie großer Sätze, die auf das ganze Buch zurückwirken.
Und auch in einem anderen wichtigen Punkt bleibt Houellebecq mit „Vernichten“ bei seiner Tradition: Von Anfang an, von „Ausweitung der Kampfzone“, „Elementarteilchen“ und „Unterwerfung“ bis zu diesem vorläufigen Schlussstück machte er immer Gedanken zu Literatur, die außer ihm bis dahin noch keiner auf den Begriff bringen konnte.
Ein spiritistisches Medium besitzt angeblich die Fähigkeit, in die Zukunft, Vergangenheit oder beides zu sehen. Der französische Autor besitzt die unterschätzte Fähigkeit, wie ein Medium eine Struktur in der Gegenwart zu erkennen, wo andere nur Nebel wahrnehmen.
Wer etwas über unsere Jetztzeit wissen will, erfährt seit fast dreißig Jahren bei Houellebecq mehr als in den Zeitungen. Und nur mit dieser Geistesgegenwart lässt sich auch die Zukunft ahnen.
Houellebecq ist Medium und Botschafter zugleich.
Michel Houellebecq: „Vernichten“
DuMont, 624 Seiten, 28 €
Genaueres malt er sich aus
Der 80-jährige Frank Böckelmann legt mit „Die Säumigen“ sein Prosadebüt vor – ein Überraschungsstreich. Mit Witz und Scharfsicht beschreibt der Autor das Verpassen und Verfehlen als Lebensprinzip
Eine berühmte Geschichte Franz Kafkas erzählt von den Geschäften des Poseidon. Der Meeresherrscher verbringt sein Leben am Schreibtisch, denn „die Verwaltung aller Gewässer gab ihm unendliche Arbeit. Er hätte Hilfskräfte haben können, wie viel er wollte, und er hatte auch sehr viele, aber da er sein Amt sehr ernst nahm, rechnete er alles noch einmal durch und so halfen ihm die Hilfskräfte wenig.“ Ob er seine Arbeit einmal unterbrechen könnte, ob er sie überhaupt ableisten will, fragt sich Kafkas Poseidon nicht. Er bewältigt sie bekanntlich, weil sie ihm auferlegt war. „Am meisten ärgerte er sich“, heißt es zum Schluss der kleinen Erzählung, „wenn er von den Vorstellungen hörte, die man sich von ihm machte, wie er etwa immerfort mit dem Dreizack durch die Fluten kutschiere.“ In Wirklichkeit sitzt er, um zu rechnen. „So hatte er die Meere kaum gesehen, nur flüchtig beim eiligen Aufstieg zum Olymp, und niemals wirklich durchfahren. Er pflegte zu sagen, er warte damit bis zum Weltuntergang, dann werde sich wohl noch ein stiller Augenblick ergeben, wo er knapp vor dem Ende nach Durchsicht der letzten Rechnung noch schnell eine kleine Rundfahrt werde machen können.“
So ungefähr können wir uns den Autor Frank Böckelmann vorstellen. Auch das Leben des „Tumult“-Herausgebers spielte sich zu großen Teilen am Schreibtisch ab. Literarische Texte beschäftigten ihn reichlich, ohne dass er jemals den stillen Augenblick für einen Ausflug in die Belletristik gefunden hätte. Bis jetzt jedenfalls.
Kurz vor dem 80. Geburtstag erschien sein erster Prosaband, „Die Säumigen“. Es handelt sich um eine Rundfahrt über gerade 183 Seiten. Aber was für eine. Wo hat sich der Prosaautor Frank Böckelmann eigentlich all die Jahrzehnte versteckt? Seine Stücke, die er dort versammelt, besitzen samt und sonders Witz, und zwar in der ganz klassischen Bedeutung dieses Wortes. „Die Säumigen“ versammelt Texte, die sich in der Schwebe zwischen Fragment und Kurzgeschichte halten. Manche wirken wie Mikroromane. Der Autor führt sein Thema durch mehr als ein Dutzend Variationen: das Verpassen, Verbummeln, Zuspätkommen, Gerade-so-Tangieren.
Eine Jugendgeschichte erzählt von einem säumigen Schüler, andere von säumigen Autoren. Es treten Karriereverfehler und säumige Liebhaber auf. Alle Varianten des Trödelns kommen in dem schönen Böckelmann-Wort zusammen, der „Lebenssäumigkeit“. An irgendeiner Stelle erkennt sich vermutlich jeder in einem der Texte wieder. Die häufigsten Gelegenheiten des Lebens sind natürlich die verpassten.
Worin liegt nun der Witz? Darin, dass seine Geschichten vom Verpassen mit Leichtigkeit auf die Ebene der Verdichtung kommen. Es ist vor allem der Ton, der seine Texte trägt, eine abgeklärte, fließende Sprache. Von seinen Figuren geht ein Wärmefluss aus. Wenn Böckelmann über säumige Autoren schreibt, dann schaut zunächst einmal der Zeitschriftengründer und intime Kenner auf den Betrieb: „Ein Koautor, der schon mehrmals geschoben hatte und deswegen Sondergaben von Optimismus erhielt, präzisierte den Zeitpunkt, zudem er wenigsten die Hälfte des anfangs Zugesagten, wenigstens ein Viertel, wenigsten ein Kapitel, wenigstens die Einleitung, wenigstens deren Skizze liefern würde. Und wenn es bis Weihnachten nicht gelang, so doch bis Ostern, na ja, spätestens bis zum Ende des Sommersemesters.“ Bei einer Satire bleibt es eben nicht; in dem Text geht es eigentlich um das Drama des Gabor Schmidt, der als Herausgeber seine säumigen Autoren immer wieder ins nächste Versagen jagt, der sie quält, von ihnen zurückgequält wird und sich fragt, warum er es nie schaffte, dieser Rolle aus dem Weg zu gehen.
In der Jugendgeschichte über den säumigen Schüler verfolgt der Autor wieder eine ganz andere Spur, die des Trödelns, Abweichens und Weglaufens als Streifzug durch eine Kleinstadt, Serendipity, also Entdeckung ohne zielstrebiges Suchen, in diesem Fall während der Pubertät. Dem Jungen bereitet es Vergnügen, sich nach der Schule durch die Straßen treiben zu lassen und in fremde Häuser zu gehen, ohne genau zu wissen, was er dort will. „Unversehens gehörte er dazu, und die Leute bekamen Lust, ihn, den adretten Knaben, als einen der ihren zu behandeln. Seltsam ungezwungene Gespräche entspannen sich, in denen er neben sich selbst stand. Man lud ihn zu Kaffee und Kuchen und kleinen Räum- und Reparaturarbeiten ein. Die Leute waren stets Mädchen oder Frauen oder vergrübelte Sonderlinge. Genaueres malte er sich nicht aus.“
Wie ein Mikroroman erzählt „Der säumige Student“ von der Bummelstudentenwelt und ihrem gleitenden Übergang in den Mikrokosmos linksorthodoxer Theoriezirkel – auch ein guter Weg, um etwas anderes nicht wahrzunehmen.
Am erstaunlichsten wirken Böckelmanns Erzählungen über die säumigen Liebhaber. Denn sie spielen in der Welt der mittelalten Stadtbewohner, der elektronischen Kontaktbörsen, der Fernbeziehung, der Geschlechterverhältnisse, die eher ökonomischen als herkömmlich erotischen Kriterien folgen. Auf diese Gegenwart schaut Frank Böckelmann nicht vom Hochsitz seiner 80 Jahre. Er bewegt sich in diesen Milieus wie ein Fisch im Wasser. Hier entfaltet sich auch sein Talent zur Komik am stärksten.
Eine Geschichte handelt von einem öffentlichen Paar, das eher zum Zweck weiterer Geschäftsfelderschließung fusioniert, statt sich traditionell zu binden, „der drahtige Kulturdezernent einer kleineren Großstadt im Ruhrgebiet, Anfang vierzig, und die elegante Dokumentarfilm-Regisseurin, Mitte dreißig“. Wie sich eine Seite später herausstellt, versäumte er es allerdings, das körperliche Portfolio seiner Fusionspartnerin rechtzeitig auf Schwächen abzuklopfen. Es ist hochkomisch, wie er zu spät entdeckt, dass an einer bestimmten Stelle etwas nicht stimmt. Auch die kleinen apodiktischen Sätze über seine Figuren steigern das Vergnügen an den Texten. Über ein anderes Paar heißt es: „Im Fach Erotik hatten sie zwei Jahrzehnte mit ‚Larifari‘ und ‚Schnickschnack‘ ihr Auskommen gefunden.“
Frank Böckelmann besitzt die in Deutschland ziemlich rare Fähigkeit, über Gesellschaft zu schreiben. Das konnte Botho Strauß beispielsweise in „Paare, Passanten“, das tut Martin Mosebach in den meisten seiner Romane. Schreiben über die Gesellschaft fällt deshalb nicht leicht, weil es dazu einen geschärften Blick braucht, aber auch die Fähigkeit, seine Figuren trotz der luziden Sicht nicht zu denunzieren. Seine erstaunliche Biografie hilft womöglich auf beiden Feldern, jedenfalls steht sie ihm nicht im Weg.
Böckelmann, 1941 in Dresden geboren, gehörte in den Sechzigern zu den Kadern des SDS und dort zu den Weggefährten Rudi Dutschkes, betrieb später Medienforschung in München, verfasste mehrere Sachbücher und gründete 2014 das Magazin „Tumult. Vierteljahresschrift für Konsensstörung“. Einige versuchen ihm das Etikett „Rechtspopulist“ und ähnliche Markierungen anzukleben, die allerdings wegen ihrer Inflationierung nichts bewirken und nichts bezeichnen. Leute, die häufiger ‚Nazi‘ als ‚guten Tag‘ sagen, schreiben auch keine Bücher, deren Besprechung lohnt.
Sollte aus einem der Mikroromane noch ein vollumfänglicher Roman wachsen? Vielleicht. Allerdings verdanken Böckelmanns Prosatexte ihre Würze vor allem der Reduktion bis hin zum Fragment. „Die Säumigen“ versammeln durchweg Essenzen.
Aber ein paar Rundfahrten sollte der Autor unbedingt noch unternehmen.
Frank Böckelmann: „Die Säumigen“
Manuscriptum, 186 Seiten, 19 €
Souverän ist, wer versprechen und töten kann
Jörg Baberowskis „Der bedrohte Leviathan“ betrachtet die Revolutionen 1917 durch das Raster Carl Schmitts. Seine Studie über Machttechnik und Herrschaft schärft nebenbei auch den Blick auf das Russland der Gegenwart
Über den Leviathan heißt es im Buch Hiob: „Wenn er daherbricht, so ist keine Gnade da.“ In seiner Staatstheorie gab Thomas Hobbes aus guten Gründen seinem Idealstaatsentwurf den Namen des biblischen Schreckenstiers: Die zentrale Gewalt soll bei ihm durch ihren Schrecken alle partikularen Gewalten einschüchtern, den Krieg aller gegen alle beenden und den Bürgern Sicherheit gegen Gehorsam garantieren.
Der Historiker Jörg Baberowski benutzt in seinem Buch „Der bedrohte Leviathan. Staat und Revolution in Russland“ die Umbrüche von der Ermordung Alexander II. 1881 bis zu Lenins Oktoberrevolution 1917 als Stoff, um daraus grundsätzliche Fragen zu beantworten: Worauf ruht eine Staatsmacht überhaupt? Was bringt ihre Säulen ins Wanken? Warum gelingt manchen Revolutionären die Machtergreifung, anderen nicht? Und wie kommt es, dass eine winzige gesellschaftliche Gruppe einen Staat und die halbe Welt umwälzen und ähnlich wie der biblische Leviathan mit ihrem Schrecken überziehen kann?
Der Historiker Jörg Baberowski ist neben seinem Kollegen Karl Schlögel der beste deutsche Russlandkenner. In seinen Büchern beschäftigte ihn immer ein Kernthema, das auf alles andere ausstrahlt: Die Gewalt als Mittel der Politik. Darüber schrieb er in „Der Rote Terror“, „Verbrannte Erde“, in dem 2012 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse prämierten Standardwerk „Stalins Herrschaft der Gewalt“ und wieder in der Abhandlung „Räume der Gewalt“, die der entgrenzten Brutalität im östlichen Europa während des 2. Weltkriegs nachgeht. Bei seinem „Bedrohten Leviathan“ handelt es sich um den Text der 3. Carl-Schmitt-Vorlesung, zu der er von der Carl-Schmitt-Gesellschaft eingeladen worden war. Baberowskis Betrachtungen sind einerseits zeitlos, andererseits gewinnen seine Gedanken über den russischen Staat und seine Gewaltgeschichte vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine eine große Aktualität. Sie tragen zum besseren Verständnisse der blutigen Ereignisse in Osteuropa bei, denn Baberowski beschäftigt sich nicht nur mit den Umbrüchen in der russischen Gesellschaft, sondern auch mit ihren Kontinuitäten: Die Konzentration auf eine Figur auf der Staatsspitze, das Denken in imperialen Kategorien – und die Bereitschaft, die eigenen Ziele notfalls mit roher Gewalt durchzusetzen.
Der Autor spannt den Bogen zwar bis 1881, der ersten Erschütterung der Monarchie durch die Ermordung des Reformzaren Alexander II. Aber vor allem die entscheidenden Monate zwischen Februar und November 1917 betrachtet er durch das Prisma des Staatsrechtlers Carl Schmitt, für den bekanntlich der Erhalt der staatlichen Ordnung an erster Stelle stand. Von dieser Position aus irrte der Jurist in den dreißiger Jahren auch ab zu einer Apotheose des Nationalsozialismus. Aber darin liegt nicht der Kern seines Denkens. Mit seiner „Verfassungslehre“ von 1928 und seinen Arbeiten nach seiner Lösung von dem NS-Staat bleibt er bis heute ein Rechtsphilosoph, der andere zu einer produktiven Auseinandersetzung herausfordert.
In Zeiten des Kriegs, der Rückkehr der Machtraum-Strategie und der neuen und alten Hegemonen gilt das wahrscheinlich mehr als in der kurzen Eopche, in der das Ende der Geschichte etwas voreilig ausgerufen wurde. Wo Francis Fukuyama abdankt, kehrt Schmitt zurück. Wirklich verschwunden war er samt seinen Theorien sowieso nie.
„Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet“, lautet das bekannteste Theorem Schmitts. Staatszusammenbrüche und Revolutionen sind Ausnahmezustände schlechthin. Das Verdienst des Autors liegt zunächst einmal darin, die Februarrevolution und schließlich die Machtergreifung Lenins als Abfolge von unglaublichen Zufällen und Wendungen nachzuzeichnen. Bis buchstäblich zum letzten Moment hätte alles auch anders kommen können. Irgendeine Zwangsläufigkeit, so Baberowski, habe im Petrograder Frühjahr 1917 nicht existiert:
„Nirgendwo gab es überhaupt Anzeichen für eine bevorstehende Revolution. Und dann geschah doch, was niemand für möglich gehalten hatte: die Brotrevolte verwandelte sich in eine Revolution mit ungewissem Ausgang.“
Denn in einem System mit der allesentscheidenden zentralen Herrscherfigur hätte nur der Zar den Ausnahmezustand diktieren und seine Souveränität beweisen können. Dazu sah sich der schwache Nikolai II. aber nicht in der Lage. „“Deshalb“, so Baberowski, „verwandelten sich die Defekte des zaristischen Regierungssystems in diesen Tagen in eine tödliche Waffe.“
Nikolai scheitert im nächsten Schritt auch daran, seine Macht zu übertragen: Er dankte ab, rief seinen noch minderjährigen Sohn als Nachfolger aus, nahm die Entscheidung aber noch am gleichen Tag zurück, um seinen Bruder zur Thronbesteigung aufzufordern. Als auch der ablehnte, fiel die monarchistische Machtlegitimation buchstäblich ins Nichts.
Die auf den Zaren folgende Provisorische Regierung konnte sich nicht mehr auf die Tradition berufen, aber auch nicht auf eine Legitimation durch Wahlen. Wäre sie von tatkräftigen Personen geführt worden, schreibt Baberowski, dann hätte sie auch das entscheiden können, was Lenin dann verkündete, nämlich einen Waffenstillstand und die Verteilung von Grund und Boden. Aber die Führer der Provisorischen Regierung meinten, das könnte nur ein gewähltes Parlament. Stattdessen lösten sie die letzten Bindungen im Staat, indem sie die Gouverneure der Provinzen für abgesetzt erklärten, aber keine neuen ernannten und meinten, über diese Positionen sollte in den Regionen selbst entschieden werden. Selbst die Polizei zerstreute sich. Der Leviathan bedrohte nun nicht mehr die anarchischen Kräfte und Partikularinteressen, er geriet selbst in eine tödliche Bedrohung. Ein Staat, der keinen Schutz mehr bieten will und kann, darf auch keine Gefolgschaft mehr verlangen.
In dieser Situation griff Lenin mit seinen Genossen nach der auf der Straße liegenden Macht. Er tat das erfolgreich, weil er nicht nur die Macht wollte, sondern, wie der Historiker schreibt, auch „konnte, was er wollte“. Die Bolschewiki stellten zwar eine kleine Gruppe, aber sie besaßen die nötige Organisation, sie beherrschten die Technik des Aufstandes, sie scherten sich nicht um die formale Legitimationsfrage, vor allem aber kannten sie keinen Skrupel, das Land zur Befestigung ihrer Macht in den Bürgerkrieg zu stoßen. In der Skizze dieser beiden Revolutionen lässt sich auch nachlesen, wie sehr es zu Beginn auf die Nutzung des Moments ankam, auf den Willen zur Machtergreifung.
Die Truppen der Bolschewiki besetzten den Winterpalast praktisch kampflos, ihr Revolutionsakt bestand im ersten Moment darin, die Minister der Provisorischen Regierung zu verhaften. Bei den späteren Bildern vom „Sturm auf das Winterpalais“, die viele bis heute für historische Dokumente halten, handelt es sich um Szenen aus Eisensteins Film „Oktober“. In Wirklichkeit fand nicht nur der militärische Sturm nicht statt; viele Stadtbewohner bemerkten es an diesem Abend noch nicht einmal, dass gerade ein wirklicher Zeitenwechsel stattgefunden hatte.
„Macht gründet sich auf Versprechen und Drohung, Autorität auf Bewährung“, so Baberowski.
Bewährt hatte sich 1917 niemand, die Provisorische Regierung nicht, die Bolschewiki genauso wenig. Aber mit dem Friedensschluss und der Landverteilung gaben sie Versprechen (die sie dann beide wieder einkassierten), mit ihrem Terror hielten sie ihre Feinde in Schach.
Ein erfolgreicher Putschgeneral, der im letzten Augenblick noch hätte auftauchen können, um die Reste der alten Ordnung zu retten – etwa ein Kornilow – hätte den Ausnahmezustand irgendwann auch beenden müssen. Lenin und seine Gefolgschaft machte den Ausnahmezustand dagegen zum Herrschaftsinstrument, mit dem sie fortwährend die Kräfte der Gesellschaft gegen innere und äußere Feinde mobilisierten.
„Die bolschewistische Herrschaft“, so heißt es in „Der bedrohte Leviathan“, „war der Urheber des Ausnahmezustandes, als dessen Bezwinger sie sich verstand. Sie produzierte Krisen und Feinde, um vor allen Augen zu demonstrieren, daß sie selbst es in der Hand hatte, den Ausnahmezustand zu erklären und nach Lage der Dinge zu entscheiden, auf welche Weise er sich überwinden ließe.“
In Jörg Baberowskis Analyse zeigen sich erstaunliche Parallelen zu Wladimir Putins Prinzip der dauerhaften Eskalation. Und übrigens auch zu dem Schwachpunkt des zaristischen Systems, in dem Wohl und Wehe des gesamten Herrschaftsgebäudes an einer einzigen Figur hing.
Der schmale Band mit seinen 126 Seiten führt seinen Lesern auch vor Augen, wie sehr das Denken von vermeintlichen Antipoden wie Carl Schmitt und Lenin einander ähnelte. Beide wussten, dass Machtgewinnung und Machterhalt ganz wesentlich auf Fragen der Machttechnik hinauslaufen.
Souverän ist derjenige, der es schafft, den historischen Zufall für seine Sache zu nutzen.
Jörg Baberowski: „Der bedrohte Levianthan. Staat und Revolution in Russland“
Duncker & Humblot, 126 Seiten, 26,90 €
Weitere Empfehlungen
Der Preis der Naivität
„Lehren aus 9/11. Zum Umgang des Westens mit dem Islamismus“, herausgegeben von Sandra Kostner und Elham Manea, versammelt insgesamt 18 Texte über das systematische Kleinreden und Unterschätzen der islamischen Eroberungsideologie bis hin zur Apologetik. Zu den Autoren gehören die Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter und der Migrationsforscher Ruud Koopmans, die Autorinnen Ayaan Hirsi, Necla Kelek und etliche andere.
Gerade die Spannbreite der Autoren von links bis libertär und liberal-konservativ macht den Wert dieses Buches aus.
Sandra Kostner / Elham Manea (Hrsg.): „Lehren aus 9/11: Zum Umgang des Westens mit Islamismus“
ibidem, 414 Seiten, 22 €
Der Reiz, am Rand zu spielen
Nicht dazuzugehören – wozu auch immer – schärft seit eh und je den Blick. In dem Band „Außenseiter. Von Rebellen, Heiligen und Künstlern auf der Klippe“ finden sich zehn Texte von Matthias Matussek über diejenigen, die in ihrer Zeit an der Peripherie und darüber hinaus operieren und trotzdem meist mehr bewirkt und mehr hinterlassen haben als ihre Zeitgenossen, die fest im Zentrum standen. Fast alle Texte Matusseks stammen aus seinem früheren Wirkungsfeld, dem Spiegel, einer aus der Weltwoche. Obwohl ihre Erstpublikation meist lange zurückliegt, wirken seine Essays über Heinrich Heine, Georg Büchner, Friedrich Hölderlin, James Joyce, Cormac McCarthy und Clint Eastwood jugendfrisch. „Die Lunte glimmt“, heißt es bei Matussek über Büchner. Das gilt generell für seine Texte: Da schreibt jemand, dem es Spaß bereitet, Zündschnüre anzustecken.
Matthias Matussek: „Außenseiter. Von Rebellen, Heiligen und Künstlern auf der Klippe“
Edition BuchHaus Loschwitz, 216 Seiten, 19 €
Die Kultur des Weglöschens
Kolja Zydatiss bietet in „Cancel Culture. Demokratie in Gefahr” einen reichen Überblick über die mittlerweile geläufige Praxis der Meinungsskandalisierung in Deutschland. Bekanntlich lauten die Argumente der Diskursaufpasser, erstens gebe es gar keine Cancel Culture, und falls doch, dann gebe es sie völlig zu Recht. Zydatiss‘ Beispielsammlung samt Analyse liefert seinen Lesern gute Argumente gegen beide Behauptungen. Und auch eine einfache, aber zutreffende Definition des Phänomens: „Ziel der Cancel Culture ist die Verengung des Meinungsraums.“
Kolja Zydatiss: „Cancel Culture. Demokratie in Gefahr”
Solibro Verlag, 184 Seiten, 16,80 €
Außerdem bittet Publico um freundliche Beachtung der Promotion für die Hörbücher aus dem John-Verlag: „Wirecard“, „Der Pate von Berlin“ und „Auf der Straße gilt unser Gesetz“; außerdem weist Publico auf Titus Gebels Plädoyer „Freie Privatstädte“ hin – jeweils zu bestellen direkt bei den Verlagen (siehe Publico-Seitenrand rechts).
2 Kommentare
Liebe Leser von Publico: Dieses Onlinemagazin erfüllt wie eine Reihe von anderen Medien, die in den letzten Jahren entstanden sind, eine zentrale und früher auch allgemein selbstverständliche publizistische Aufgabe:
Es konzentriert sich auf Regierungs- und Gesellschaftskritik.
Offensichtlich besteht ein großes Interesse an Essays und Recherchen, die diesen Anspruch erfüllen.
Das jedenfalls zeigen die steigenden Zugriffszahlen.
Kritik und Streit gehören zur Essenz einer offenen Gesellschaft.
Für einen zivilisierten Streit braucht es gut begründete Argumente und Meinungen, Informationen und Dokumentationen von Fakten.
Publico versucht das mit seinen sehr bescheidenen Mitteln Woche für Woche aufs Neue zu bieten.
Dafür erhält dieses Magazin selbstverständlich kein Steuergeld aus dem Medienförderungstopf der Kulturstaatsministerin Claudia Roth, kein Geld aus dem Fonds der Bundeszentrale für politische Bildung (obwohl Publico zur politischen Bildung beiträgt) und auch keine Überweisungen von Stiftungen, hinter denen wohlmeinende Milliardäre stehen.
Ganz im Vertrauen: Publico möchte dieses Geld auch nicht.
Die einzige Verbindung zu diesen staatlichen Fördergeldern besteht darin, dass der Gründer des Magazins genauso wie seine Autoren mit seinen Steuern dazu beiträgt, dass ganz bestimmte Anbieter auf dem Medien- und Meinungsmarkt keine Geldsorgen kennen.
Es gibt nur eine Instanz, von der Publico Unterstützung annimmt, und der dieses Medium überhaupt seine Existenz verdankt: die Leserschaft.
Alle Leser von Publico, die uns mit ihren Beiträgen unterstützen, machen es uns möglich, immer wieder ausführliche Recherchen, Dossiers und Widerlegungen von Falschbehauptungen anzubieten, Reportagen und Rezensionen.
Außerdem noch den montäglichen Cartoon von Bernd Zeller. Und das alles ohne Bezahlschranke und Abo-Modell. Wer unterstützt, sorgt also auch für die (wachsende) Reichweite dieses Mediums.
Publico kann dadurch seinen Autoren Honorare zahlen, die sich nicht wesentlich von denen großer Konzernmedien unterscheiden (und wir würden gern noch besser zahlen, wenn wir könnten, auch der unersetzlichen Redakteurin, die Titelgrafiken entwirft, Fehler ausmerzt, Leserzuschriften durchsieht und vieles mehr).
Jeder Beitrag hilft.
Sie sind vermutlich weder Claudia Roth noch Milliardär.
Trotzdem können Sie die Medienlandschaft in Deutschland beeinflussen.
Und das schon mit kleinem Einsatz.
Der Betrag Ihrer Wahl findet seinen Weg via PayPal – oder per Überweisung auf das Konto
(Achtung, neue Bankverbindung!)
A. Wendt/Publico
DE88 7004 0045 0890 5366 00,
BIC: COBADEFFXXX
Dafür herzlichen Dank.
Die Redaktion




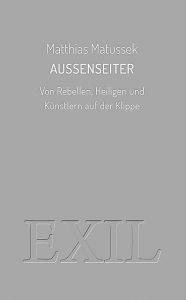
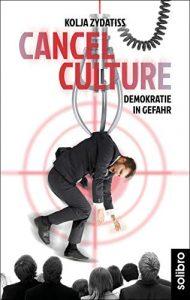




pantau
15. April, 2022Vielen herzlichen Dank auch für diese absolut fesselnden Buchbesprechungen, Herr Wendt!
«Ein spiritistisches Medium besitzt angeblich die Fähigkeit, in die Zukunft, Vergangenheit oder beides zu sehen. Der französische Autor besitzt die unterschätzte Fähigkeit, wie ein Medium eine Struktur in der Gegenwart zu erkennen, wo andere nur Nebel wahrnehmen.»
Wie wahr..
D. Michels
16. April, 2022Danke für die brillant formulierten, appetitanregenden Rezensionen und für die Hinweise auf die Hörbücher. Sämtliche Bücher würden mich reizen.
Die Unkultur der Cancel Culture ist meines Erachtens eine der gefährlichsten Verirrungen in unserer an Verirrungen nicht gerade armen Zeit. Den Autor Kolja Zydatiss kenne ich von seiner Rubrik in der Achse des Gute «Ausgestoßene der Woche». Sehr lesenswert, aber nichts für schwache Nerven. Schade, dass es das Buch Cancel Culture anscheinend (noch) nicht als Hörbuch gibt.
Frohe Ostern, auch wenn’s schwer fällt.